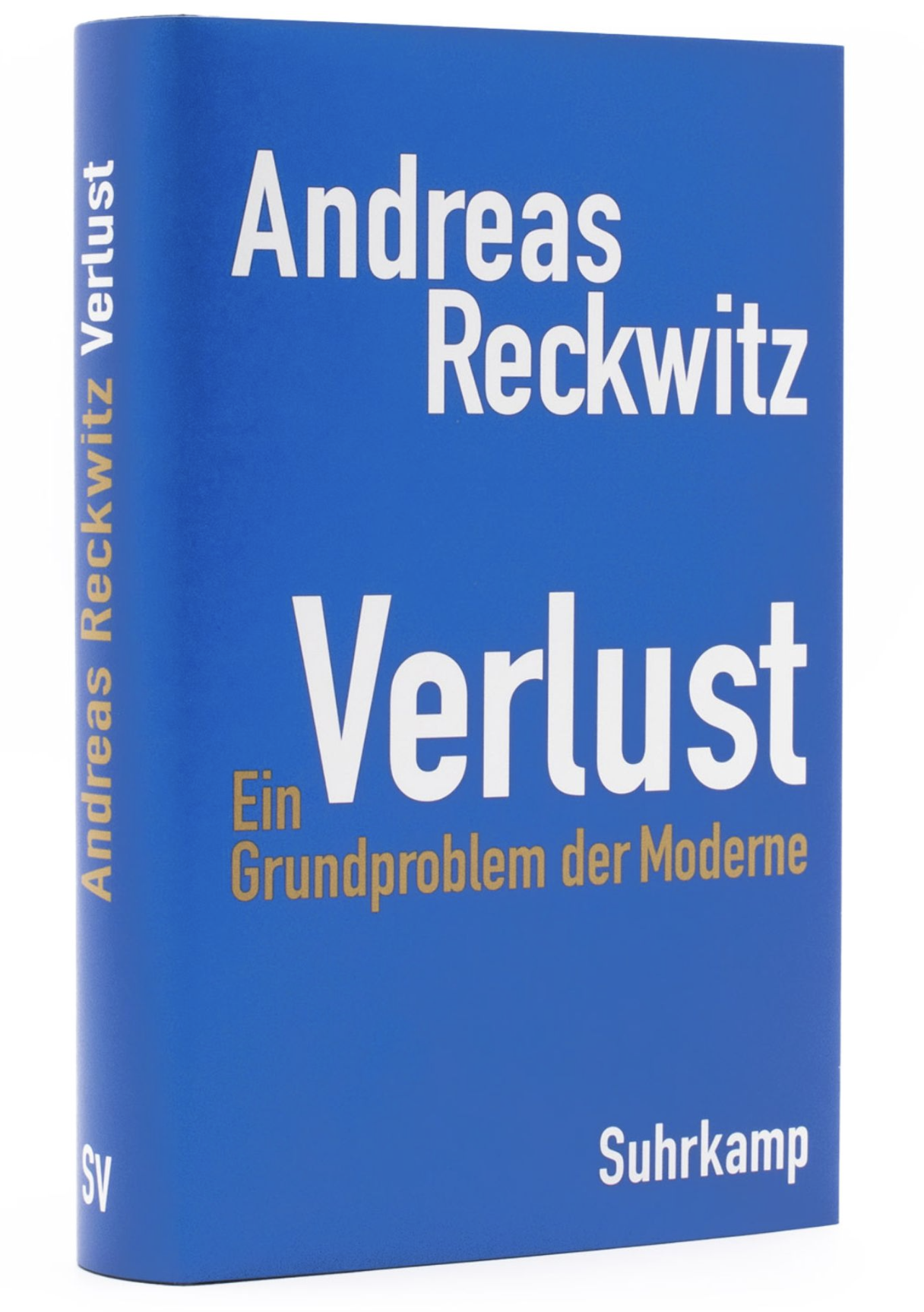von Gottfried Timm
Der Soziologe Andreas Reckwitz hat eine Vielzahl von Verlusten beobachtet. Verlust von Nachbarschaftsbeziehungen und Vereinsleben, Verlust von handwerklichem Wissen und traditionellem Können, von überlieferten Bräuchen und kultureller Identität. Verlust von Industriearbeitsplätzen durch Automatisierung und Digitalisierung. Verlust von natürlichen Lebensräumen und Verlust der Artenvielfalt. Verlust von vorgezeichneten Lebensmodellen durch Fragmentierung und Brüche in der eigenen Biografie. Verlust von familiärer Bindung und Nähe. Verlust der Gewissheit, zu etwas Größerem dazuzugehören.
Fortschritt als Motor
Verluste, schreibt Reckwitz, hat es natürlich schon immer und in allen Kulturen gegeben, aber die Gegenwart unserer westlichen, postmodernen Gesellschaft wird dadurch geprägt, dass sie eine integrierende Beziehung zu Verlusterfahrungen „verloren“ hat. Diese Gegenwart lässt sich verstehen, wenn wir einen Blick auf die Vergangenheit werfen. Reckwitz analysiert die Moderne als eine Epoche der Säkularisierung, der Aufklärung, der Individualisierung und der Demokratisierung, die sich seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat und sich in diesen Merkmalen deutlich von der vormodernen Zeit abhebt. Der Moderne sei der „Fortschritt“ als Motor ihrer Entwicklung eingeschrieben, in der Verluste als „Kollateralschäden“ hingenommen wurden, ja, der Bruch mit Überholtem durch die Lust am Verlust, am „Tabubruch“, aktiv herbeigeführt wurde. Genau das sei der Widerspruch der modernen Gesellschaft, der in der postmodernen Gegenwart nicht mehr zugedeckt werden könne: Der Fortschrittsimperativ produziert Verluste, die er aus seiner Ursprungserzählung über sich selbst entfernt hat.
Grenzen des Wachstums – Club of Rome
Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts zeige sich dieses deutlich. Eine von mehreren Wegmarken ist für Reckwitz die Schrift Grenzen des Wachstums, Bericht des Clubs of Rome zur Lage der Menschheit. Seither stünden Verluste im besonderen Fokus der persönlichen und öffentlichen Aufmerksamkeit. Diese erstreckt sich von Reiseangeboten zu lost places in devastierten Gebieten urbaner Regionen über eine Zunahme von individuellen Beratungs- und Psychotherapieangeboten etwa zu Verlusttraumata bis hin zu breit angelegten öffentlichen Debatten über „historische Wunden“ wie Kriegstraumata, kolonialistische Verbrechen oder Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. In der Postmoderne gäbe es eine besondere Kultur der Hinwendung zum Negativen. Das zeige sich besonders im Umgang mit dem Tod, etwa in der Hospizbewegung oder in Formaten gemeinsamer Trauer im digitalen Raum. In der klassischen Moderne sei dieses ein Tabuthema gewesen – wobei der Autor an dieser Stelle einen Blick auf die (inzwischen fast verlorene) Bestattungskultur der Kirche und die Rolle von tradierten Trauerritualen der Familien hätte werfen können.
„Make America Great Again“ – der frühere Wahlslogan von Donald Trump bringe die Stoßrichtung der politischen Neuentwicklung in der Spätmoderne, die Stoßrichtung des Populismus, auf den Punkt. In dieser drehe sich alles um Verluste, um Statusverluste, Machtverluste, um einen befürchteten gesellschaftlichen Niedergang, um den Verlust von Zukunftsgewissheit. Ehemalige ideale, jedenfalls bessere oder gesichertere Verhältnisse sollen wieder hergestellt werden. Noch mehr: Um des politischen Erfolges willen werden Verlustängste geschürt und Ereignisse inszeniert, die diese gezielt herbeiführen. Der Populismus sei ein politisches Geschäft mit Verlusten.
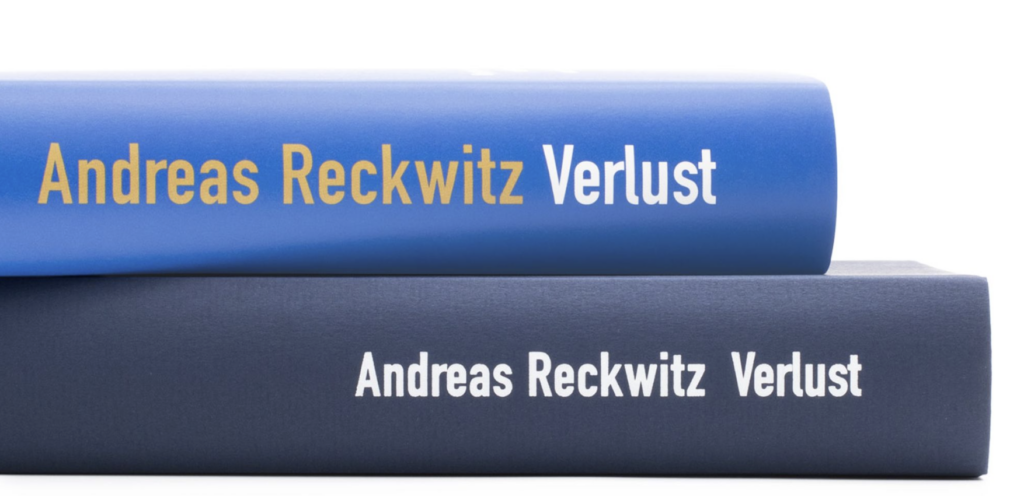
Reckwitz verfolgt in seiner soziologischen Analyse des Verlustes eine komplexe Aufgabe. Er bezieht die Emotionalität von Gesellschaften mit ein, ihre Selbstwahrnehmung vor allem in Narrativen (d.h. in Erzählungen und nicht allein durch rationalen Wissenstransfer) sowie ihren fortlaufenden Wandel. Das Verschwinden von etwas ist per se noch kein Verlust, so Reckwitz, sondern erst dann, wenn mit diesem (auch teilweise) die individuelle und die gesellschaftliche Identität verloren geht, mithin dieser Prozess negativ, schmerzhaft empfunden wird. Wenn also im Umkehrschluss das Verschwinden von etwas nicht zu Verlusterfahrungen, zum Verlust von Sicherheiten und zu kollektiven Ängsten führen soll, dann besteht eine gesellschaftspolitische Aufgabe darin, Verlustwahrnehmungen in die kollektive wie schon in die individuelle Identitätsentwicklung beispielsweise durch Rituale des Abschiednehmens zu integrieren, also deren Abspaltung im Fortschrittsnarrativ zu überwinden. Dies allerdings in einem Moment, in dem die Fortschrittsorientierung erodiert und die Verlusterfahrung eskaliert.
Populismus – Herausforderung für die Demokratie
Soweit zu dem fundierten, in einem weiten Bogen entworfenen, für eine breitere Leserschaft wohl eher nicht gedachten Werk von Reckwitz. Was heißt das für die angewandte Politik?
Der Populismus in Mecklenburg-Vorpommern wird verständlicher, wenn auch keineswegs entschuldbarer. Die Anknüpfung an die DDR und, beim Rechtsextremismus, an den Nationalsozialismus erklärt sich daraus, verkürzt gesagt, dass die Vergangenheit der hiesigen Region den Stoff dafür liefert. Einen anderen Populismus kann es nicht hier, aber andernorts durchaus geben. Die große Herausforderung der demokratischen Gesellschaft und ihrer politischen Eliten bestehe darin, Verlusterfahrungen zu integrieren und ihre Institutionen zu stabilisieren, um dem Populismus (dem Rechtsextremismus ohnehin) seine Argumente zu nehmen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, denn Fragilität sei in der demokratischen Gesellschaft in ihrem Kern angelegt. Der Vertrauensverlust in die Demokratie habe mit ihrem widersprüchlichen Narrativ zu tun.
Ich lese das Buch von Reckwitz so: Ein neu gewählter Bundeskanzler sollte sich vor die Bürgerinnen und Bürger stellen und sie einladen, am Ausbau einer resilienten demokratischen Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Er setzt folgende Impulse:
Einschränkung des privaten Reichtums zugunsten einer neuen, sozial robusten Wohlfahrtsgesellschaft.
Mitarbeit an einem Fortschrittsnarrativ über eine offene, keineswegs linear „bessere“, tatsächlich unverfügbare, vor allem sozial integrierende Zukunft.
Stärkung der staatlichen Institutionen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie der Bahn, des Gesundheitssystems, der Kitas, Schulen und Hochschulen, Ausstattung der Polizeien und vieles mehr – weil der Bundeskanzler weiß, dass die Leistungsfähigkeit des demokratischen Staates in der Leistung seiner Institutionen erfahren wird.
Verlust – Ein Grundproblem der Moderne von Andreas Reckwitz, Fester Einband mit Schutzumschlag, 463 Seiten, ISBN 978-3-518-58822-2 Suhrkamp Verlag, 3. Auflage 32,00 Euro , E-book 27,99 Euro (D).