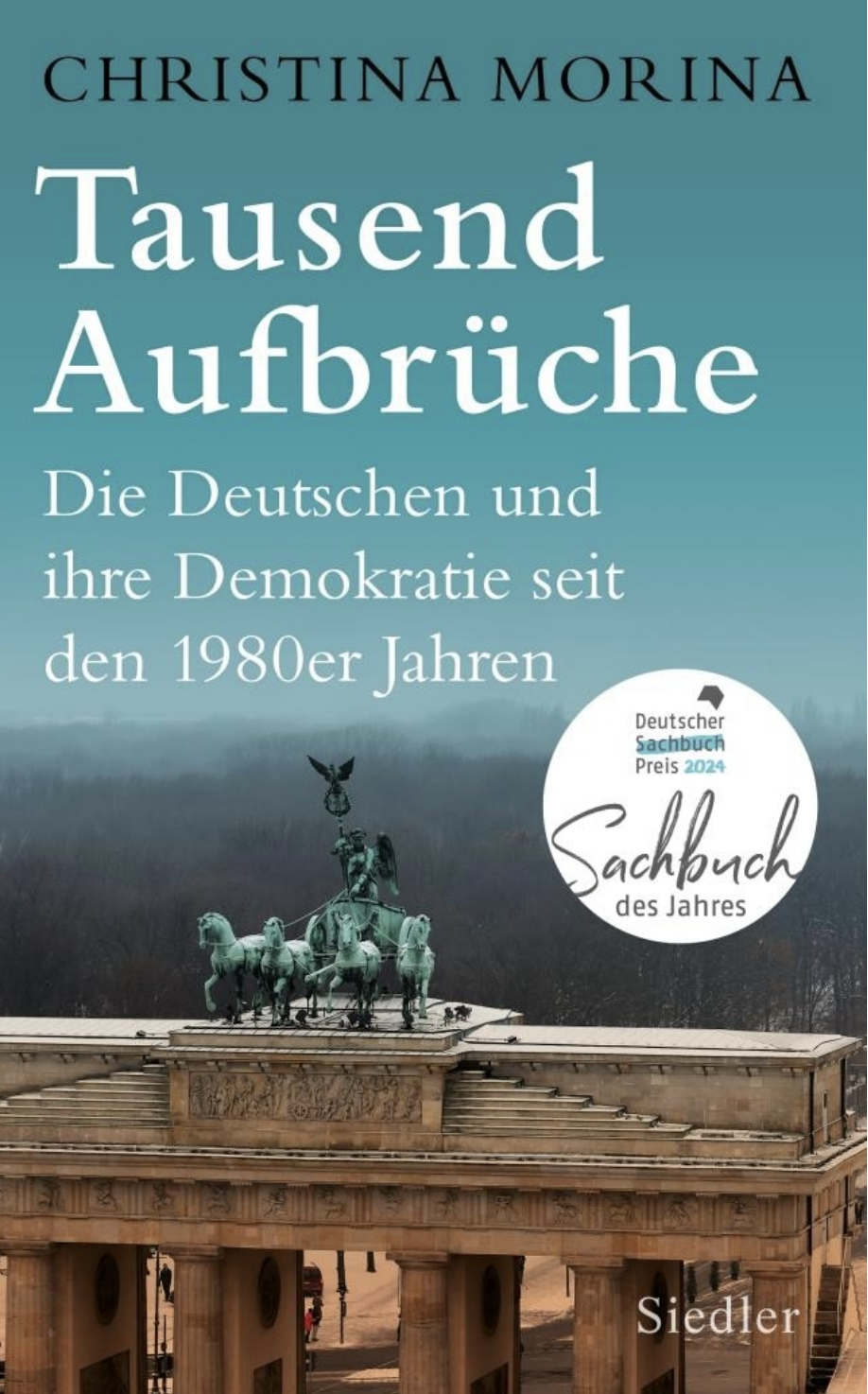von Matthias Lange
Eine Demokratiegeschichte von unten
Betrachtungen zur jüngeren deutsch-deutschen Vergangenheit gibt es mit und ohne Anlass zuverlässig zahlreich. Speziell zum ostdeutschen Blick gibt es ein weites Spektrum jüngerer Publikationen, mit erheblichen Unterschieden, was Ambition und Ansatz betrifft. Von Dirk Oschmann und Katja Hoyer über Ilko-Sascha Kowalczuk bis zu Steffen Mau reicht das hier nur grob skizzierte Spektrum – kaum jemand wird alle Titel mit gleichem Gewinn gelesen haben, Diskussionen zum Thema verraten zuverlässig erstaunlich klare Positionierungen zu den höchst unterschiedlichen Perspektiven auf den Gegenstand.
Christina Morinas „Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie“, 2024 mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet, steht etwas quer zu diesem Reigen. Und das nicht zuletzt, weil die Autorin, geboren 1976 in Frankfurt/Oder, seit 2019 Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld und zuvor Dank akademischer Stationen im In- und Ausland mit einem multiplen Blick auf deutsche Verhältnisse ausgestattet, als Historikerin das tut, was ihrem Stand geziemt: Sie arbeitet mit Dokumenten, Akten und aussagekräftigen Überlieferungen der betrachteten Zeit selbst, ordnet vergleichend ein. Sie betont den Rang der Historisierung des Prozesses von Umbruch und Aufbruch, auf struktureller wie personaler Ebene: Nur so, aus der größer werdenden Distanz können Einordnung und Verständnis wirklich gelingen. Doch ist dieser Prozess erst an seinem Anfang. Aktuell dominieren – nicht selten politisch instrumentalisierte – Debatten, Betroffenheitspositionen, „1989“ als missbräuchliche Polit-Folklore und ganz allgemein Zeitzeugenschaft, die von der Historikerzunft bekanntermaßen als natürlicher Feind historischer Wissenschaft beargwöhnt wird.

Vorteile und Risiken liegen im Grundansatz Morinas selbst, die Deutschen und die Demokratie aus westlicher wie östlicher Perspektive zu betrachten. Vorteile, weil der Vergleich die jeweils andere Perspektive verständlicher macht, weil Eigenheiten, man könnte auch sagen Trennendes in der Demokratiewahrnehmung und -erwartung plastisch zutage treten und manch divergierende Position in den deutsch-deutschen Missverständnissen der Gegenwart erklären helfen können. Risiken gibt es, weil die grundsätzliche Unterschiedlichkeit der aus der DDR-Verfassungstradition gewonnenen Perspektive auf Demokratie im Vergleich zur klar westeuropäisch und transatlantisch verorteten westdeutschen Demokratieerfahrung gelegentlich etwas verschämt-hölzern und in nur formal-begrifflicher Verwandtschaft abzubilden ist. Dass da ungleiche Geschwister in Betrachtungen zur deutschen Demokratiegeschichte analysiert werden, spricht Christina Morina selbst an: „Deutschland war von 1949 bis 1989, jedenfalls dem Anspruch nach, ein Land der zwei Republiken. Beide Teilstaaten hatten eine auf je eigene Weise streitbare Demokratiegeschichte, und diese zwei Traditionen trafen nach dem Fall der Mauer und im Zuge der Deutschen Einheit folgenreich aufeinander.“
Basis der im Buch diskutierten Begrifflichkeit demokratischer deutscher Realität sind Dokumente von „ganz normalen Leuten“, Quellensammlungen mit schriftlichen Hinterlassenschaften und Wortmeldungen von Menschen, die keinerlei herausgehobenes Amt und keine weiterreichende gesellschaftliche Verantwortung hatten, mithin für das stehen, was hier vielleicht als persönliche Dimension demokratischer Positionierung zu bezeichnen ist. Im Einzelnen sind es Briefe an die Bundespräsidenten Carl Carstens und Richard von Weizsäcker aus dem Bundesarchiv, vom Ministerium für Staatssicherheit abgefangene oder dorthin übergebene Briefe an Staats- und Parteiführung, Ministerien und Medien der DDR, dazu Petitionen, Flugschriften und Privatbriefe an das Neue Forum sowie Zeitungen der Übergangszeit, die in Berliner und Leipziger Oppositionsarchiven überliefert sind. Und schließlich eine große Zahl von Bürgerschreiben, die an die 1992/93 tagende und aus dem Einigungsvertrag hervorgegangene Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat gesandt wurden.
Vielfalt der Perspektiven
Man ahnt: Das entstehende Bild ist ungemein vielschichtig, wenig ausbeutbar im Sinne populistischer Zuspitzung – ein Blick auf eine größere Gesamtheit von Impulsen, Hoffnungen, Möglichkeiten. Christina Morina lässt die dokumentierten Stimmen zu Wort kommen, nüchtern und ohne Alarmismus in ihrem Stil. Sie hört gleichsam nachträglich zu und genauer hin, schlägt sich nicht vorschnell meinungsstark auf eine – ob vermeintlich oder tatsächlich im Recht sich wähnende – Seite, betont die Offenheit historischer Situationen, beobachtet das Aufblühen und rasche Verwelken manch kühner oder abwegiger Erwartung. So schnell, wie aus dem „Wir sind das Volk!“ der Ruf „Wir sind ein Volk!“ wurde, entflammten und verglühten Überlegungen zu umfassenden Elementen direktdemokratischer Elemente als einem möglichen Kern einer neuen, gesamtdeutschen Verfassung. Dies übrigens in scharfer Abgrenzung von der repräsentativ-parlamentarischen Tradition westlicher Prägung, der ostdeutsche Stimmen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung eines obrigkeitsstaatlich dominierten und gelenkten demokratischen Sozialismus‘ eine bemerkenswert tiefgehende Skepsis entgegenbrachten. Maßgebliche westdeutsche Akteure unterschätzten dieses bis heute in Transformationsgesellschaften präsente und aktuell maßgeblich von rechtspopulistischer Seite in vielen Ländern ins Gespräch gebrachte Element, das neben seiner eigentlichen Substanz zugleich die erstaunlich umfassende Ablehnung westlicher parlamentarischer Prozeduren einschließlich der zentralen Rolle politischer Parteien bei der Willensbildung einschließt. Morina liest hierzu in Richard von Weizsäckers Memoiren und ist erstaunt über dessen romantischen Blick auf Umbruch und Transformation: Wie von Zauberhand habe sich Ostdeutschland „rasch in ein repräsentatives System nach westlichem Muster“ verwandelt, nachdem der Elan der direkten Demokratie im Lauf des Frühjahrs 1990 erlahmt war – eine in Gesetzen und Verordnungen siedelnde, erweiterte Bundesrepublik also, in vollkommener demokratischer Verwirklichung ihrer selbst: Dies war, obwohl ein Eindruck, der an der Oberfläche dank wiedergegründeter Länder, erstmals gewählter Landtage und frisch erarbeiteter Verfassungen auf den ersten Blick nachvollziehbar ist, wohl eher der Wunschtraum, dass nun alles in wohlbekannten und -geordneten Bahnen ablaufen werde.
Andere Traditionslinien
Christina Morina geht hier erfreulicherweise den ungemütlichen Schlussfolgerungen dieses spannungsgeladenen historischen Querstands nicht aus dem Weg: Der Weg vom „Wir sind das Volk!“ zum „Straßenschrei der Pegida-Bewegung“ und durch ein rasantes Krisen-Staccato zu den Positionen der AfD in Gegenwart und jüngster Vergangenheit ist hier angelegt.
Zur Ausgangslage: Seit den 1990er Jahren war die Parteibindung in den ostdeutschen Ländern konstant schwach, dazu kamen eine bemerkenswerte Volatilität des Wahlverhaltens und die strukturelle Stärke der PDS sowie die fortdauernde Schwäche klassischer Orte der Selbstorganisation im Umfeld von Kirchen, Gewerkschaften oder Vereinen. Insgesamt hat sich aus DDR-Sozialisation und Umbruchserfahrung kein belastbares, aktionsfähiges Netz von Strukturen und Organisationen ergeben, das demokratische Kompromissfindung und Konfliktregulation dauerhaft und durchgreifend in den Herzen und Köpfen vieler Ostdeutscher hätte verankern können. Dabei schien an der Oberfläche doch vieles gut, wirkten die Ostdeutschen zumindest in der Merkel-Gauck-Zeit mehr als angemessen repräsentiert. Doch die darunterliegende, systemische Repräsentationslücke in Staat, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur blieb bestehen. Am Rande empfohlen, doch hier nicht näher reflektiert seien Christina Morinas Betrachtungen zu Angela Merkel als Ostdeutscher, Bundeskanzlerin und zeitweise übermächtiges Gesicht eines gerade im Osten oft kritisch betrachteten repräsentativen Systems: Erhellenderes wird man auf engstem Raum – und damit diesseits der Dickleibigkeit ausufernder (Auto-)Biografien – kaum anderswo finden.

.
Christina Morina weist neben einer ebenso knappen wie luziden Skizze der Etablierung der AfD als gesamtdeutscher Partei auf den Umstand hin, dass sie als einzige Partei in Deutschland dezidiert behauptet, an die vielfältigen, von manchem in verklärter Rückschau wohl allzu idealistisch bewerteten basisdemokratischen Impulse der Zeit von 1989/90 anzuknüpfen. Mit dem klaren Signal: Repräsentation in Parlamenten drückt nicht den vermeintlich eigentlichen Volkswillen aus, so wolkig oder grob Begriff und Argumentation der AfD in dieser Hinsicht auch bleiben. Diese besondere Anschlussfähigkeit der AfD an einen Teil des Erbes von 1989/90 kann Morina auch deshalb so überzeugend zeigen, weil sie den im Rückblick rasant verlaufenen Prozess der Wandlung der Partei vom westdeutsch-professoralen Anti-Euro-Impuls hin zu einem rechtsextremen Kern völkischen Nationalismus‘ schrittweise und nachvollziehbar durchmisst. Teils mit erschreckender Plausibilität, zum Beispiel in der Beschreibung, wie neu-rechte Vordenker die ostdeutsche Nachwende-Deklassierung als neue Möglichkeit sehen, eine Art heimatgebundener Überlebenskunst und Eigentlichkeit zu stilisieren, mit üppigen Anschlussmöglichkeiten an einen völkisch-plebejischen Autoritarismus, an allgemein antiliberale Tendenzen und repräsentationskritische Positionen.
Entschieden weist Morina die Versuche dieser umfassenden Vereinnahmung der Aufbruchzeit von 1989/90 zurück, mit denen man „…ein ganzes Kapitel der jüngsten, ostwestlich geteilten Demokratiegeschichte verzerrt, banalisiert und letztlich zu zerstören versucht.“ Die ostdeutsche Mehrheitsgesellschaft stellt nach ihrer Einschätzung den Beitritt zur BRD bis heute nicht in Frage, es gibt keine tatsächliche Entdemokratisierung, vielmehr echte Wertschätzung grundlegender demokratischer Realitäten und grundgesetzlicher Tatsachen. Die gesamtdeutsche Etablierung der AfD mit diversen spezifisch ostdeutschen Impulsen ist davon jedoch durchaus zu unterscheiden.
Bilanz: Gemischte Lage
Am Schluss ein Lob der soliden, kritischen Quellenarbeit: Im Wechselspiel mit Erkenntnissen der gängigen sozialwissenschaftlichen Wahl- und Einstellungsforschung erlangen Christina Morinas systematisch betrachteten Funde weit mehr als illustrativen Charakter. Besonders positiv fällt ins Gewicht, dass der Blick nicht isoliert auf die DDR und die Ostdeutschen gerichtet ist, sondern gleichermaßen nach der Demokratie in Westdeutschland gefragt wird. Der Vergleich schafft andere Perspektiven, lässt die einzelnen Segmente je im Licht des anderen Kontur gewinnen.
Besonders einsichtsvoll geraten gleichwohl einige Beobachtungen zur ostdeutschen Prägung: Die aus dem umfassenden Anspruch der DDR als „partizipatorischer Diktatur“ herkommende im Kern paradoxe Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen – auch Parteien – bei gleichzeitig umfassend erwarteter Lösungskompetenz dieses skeptisch gesehen Staatswesens; die daraus folgende Distanz zu den Prinzipien der repräsentativen Demokratie; die gleichzeitige Nähe zu direktdemokratischen Elementen – auch wenn dieser Diskurs 1989/90 wie danach inhaltlich nur von wenigen aktiv und ernsthaft geführt wurde; nicht zuletzt die bei den ostdeutschen politischen Eliten bis heute besonders deutlich zu beobachtende Orientierung auf Konsens und Harmonie, auf eine moralisch definierte Verantwortung dem sozialen Frieden wie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber.
Nicht jeder Einschätzung muss man folgen: Ob etwa die von Morina für die späten 1980er Jahre der DDR angenommene apostrophierte grundlegende Politisierung der Gesellschaft anhand der ausgewerteten Dokumente gezeigt oder nicht doch vielmehr die DDR in weiten Teilen als Nischengesellschaft für eine Mehrheit der Menschen als prägend angenommen werden kann, muss dahinstehen.
In jedem Fall ein anregendes Buch, weit jenseits griffiger Parolen und schneller Aufmerksamkeit. Sehr zu empfehlen.
„Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren“ von Christina Morina ist im Sept. 2023 im Siedler Verlag erschienen. Die Hardcover-Ausgabe (400 Seiten) kostet 28 Euro.