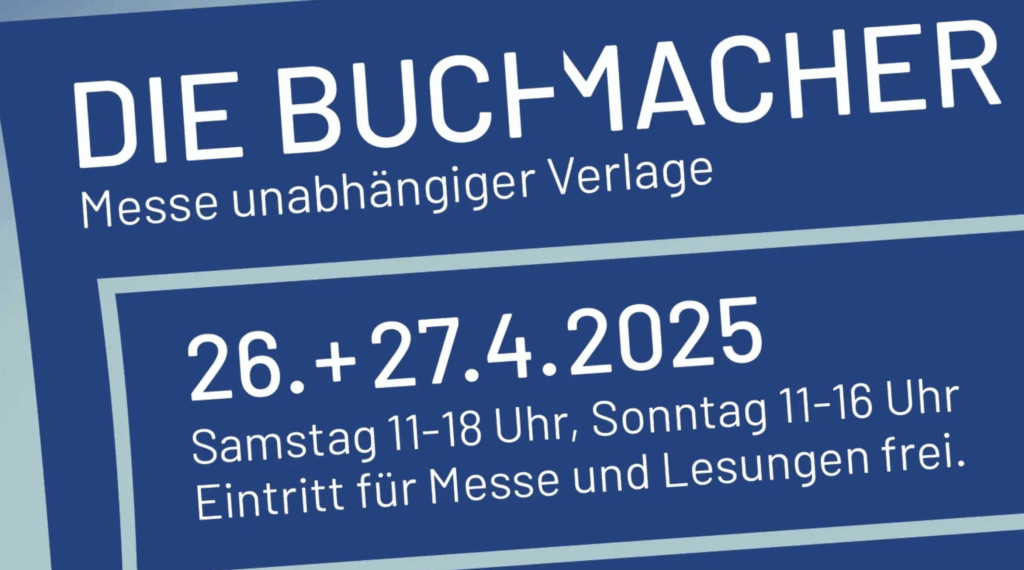Starke Operninszenierung am Schweriner Staatstheater
von Til Rohgalf
Wie brüchig sind gesellschaftliche Moralvorstellungen angesichts existenzieller Bedrohungen? Welche Rolle spielt religiöser Glaube bei der Legitimation eines kollektiven Zivilisationsbruchs? Das ist der Stoff der Oper „Strandrecht”, die im Mecklenburgischen Staatstheater inszeniert wird. Komponiert hat sie die englische Frauenrechtlerin Ethel Smyth (1858–1944).
Die Handlung ist im späten 18. Jahrhundert in Cornwall, am südwestlichen Zipfel Englands, angesiedelt: Die Bewohner*innen eines verarmten Fischerdorfes leiden Hunger. Sie nutzen das sogenannte Strandrecht, um ihr Überleben zu sichern: Hiernach ging an die Küste gespültes Strandgut verunglückter Schiffe in den Besitz der Finder*innen über. Die Bevölkerung des Fischerdorfs versorgt sich, indem sie das Leuchtfeuer an der Küste löscht und so Schiffe absichtlich fehlleitet. Wer als Schiffbrüchige*r überlebt, wird von den Dorfbewohner*innen umgebracht, denn nur so fällt ihnen das Strandgut zu.
Das räuberische Vorgehen wird durch einen angenommenen göttlichen Auftrag legitimiert. Die Dorfbewohner*innen begreifen sich als von Gott auserwählt. Pasko, das geistliche und gesellschaftliche Oberhaupt des Dorfes, predigt die Gewalt zu Gottes Ehren. Er zieht dabei Parallelen zum Volke Israel: „Das heilige Volk hat es nie als Vergehen erachtet, wenn man in Kanaan ganze Völker abgeschlachtet hat.”
Der Fischer Mark und seine heimliche Geliebte Thurza, die unglücklich verheiratete Frau Paskos, widersetzen sich dieser Unmoralität. Sie entzünden heimlich zusätzliche Leuchtfeuer und vermeiden so weitere Schiffsunglücke. Die misstrauische Dorfbevölkerung entdeckt die beiden nicht, verdächtigt aber Pasko des Verrats. Die eifersüchtige Avis setzt zudem Thurza unter Druck. Schließlich gesteht Mark seine Täterschaft und Thurza legt in Liebe zu ihm ihre Mitschuld dar. Die Dorfgemeinschaft richtet über beide und die Oper endet tragisch mit der Verurteilung zum Tod.
Die Komponistin Ethel Smyth schrieb diese Oper in ihrem eigenen, innovativen Stil. Sie nutzt Elemente der Spätromantik, aber auch des Impressionismus und geht eigene, tonale und melodische Wege. Vage Parallelen zu Werken von Richard Wagner wie im „Fliegenden Holländer” lassen sich ebenso erkennen wie zu dem mit Smyth bekannten Peter Tschaikowski. Ethel Smyth verarbeitete dezente Einflüsse folkloristischer Melodien aus Cornwall. Das dynamische Spektrum und die eruptive Kraft der Musik sind beeindruckend. Dies spiegelt auch die Bandbreite der Instrumentation wider: gesangliche Passagen, die a cappella oder von Solostimmen begleitet werden, wechseln sich mit Fortissimo-Ausbrüchen ab. Neben den Solo-Singstimmen tritt die Dorfgemeinschaft auch als Chor in Erscheinung. Mit den beschriebenen Stilelementen erzeugt Smyth eine vielschichtige und hochemotionale Musik.
Die Regisseurin der Schweriner Inszenierung von „Strandrecht”, Daniela Kerck, verortet die Handlung in einer nächtlichen Szenerie. Die Bühne ist monochrom in dunklen Grautönen gehalten, dazu schwarze Ledermäntel, dunkle Kutten und Schürzen der Akteur*innen.

Daniela Kerck schafft so zunächst einen nicht näher lokalisierbaren, universellen Handlungsort. Bereits zur zweiteiligen Ouvertüre entführt die ästhetisch beeindruckende, mehrschichtige Videoinstallation von Astrid Steiner die Zuschauer*innen geographisch an die Handlung tragende Küstenlandschaft: vertikal wie horizontal die gesamte Bühne einnehmende Schwarz-Weiß-Aufnahmen von bewegter und schäumender See. Sie porträtieren auf cineastische Weise die Naturkräfte, die sich die Dorfgemeinschaft zunutze macht. Sie stimmen ein auf die Rauheit des Lebens im Fischerdorf an der Küste Cornwalls.
Variantenreiche Videoinstallationen von Wellen oder schemenhaften Segelschiffen untermalen in unterschiedlicher Intensität das Geschehen auf der sonst minimalistisch gehaltenen Bühne. Auch die ausgewählten Requisiten sind gerade aufgrund ihrer Spärlichkeit von großem Effekt: Ein orangenes Fischernetz oder rote Grablichter als Beleuchtung des Dorfgottesdienstes sind Beispiele für die gekonnten Akzentsetzungen.
Marius Pallesen als Mark, Brian Davis als Pasko sowie Karen Leiber als Avis vom Schweriner Ensemble übernehmen tragende Rollen. Als Thurza konnte Karis Tucker gewonnen werden, die bereits an der Inszenierung des Stückes am Staatstheater Meiningen mitwirkte. Sie sang die Thurza ebenso 2022 bei der deutschen Uraufführung des französischen Originals der Oper „Les Naufrageurs” in Berlin.

Brian Davis prägt als fanatischer religiöser Anführer Pasko stimmgewaltig und mit großer Präsenz weite Teile des ersten Aktes. Beeindruckend ist seine Gesangsleistung, insbesondere aufgrund ihres Facettenreichtums. Der starke Chor des Mecklenburgischen Staatstheaters in der Rolle der Dorfgemeinschaft, zusammen mit der dynamischen Orchesterbegleitung, lässt den ersten Teil zu einem gelungen inszenierten absurden Spektakel des religiösen Fanatismus und der moralischen Verwerfung werden.
Der zweite Akt ist personell weitgehend reduzierter: Marius Pallesen (Mark) und Karis Tucker (Thurza) rücken in den Vordergrund. Ihr elegisches Duett ist sowohl kompositorisch als auch in der Schweriner Inszenierung ein Höhepunkt des Stückes. Marius Pallesen als Tenor und Karis Tucker als Mezzosopran brillieren gesanglich. Das impulsive Duett zwischen Tucker und Brian Davis (Pasko) ist gesanglich wie orchestral vielleicht der größte und spannungsreichste Moment des dritten Aktes: Pasko möchte seine Frau staffrei verschonen, denn sie bekennt sich schuldig und besteht auf den gemeinsamen Tod mit ihrem Geliebten Mark.

Das Schweriner Ensemble unter der Regie von Daniela Kerck schafft hier eine spannungsgeladene, hochdramatische und musikalisch wie visuell beeindruckende Inszenierung. Smyths vielschichtige und individuelle Musik interpretiert die Mecklenburgische Staatskapelle unter der Leitung von Mark Rohde gekonnt und nuanciert.
Das Haus mit der Operndirektorin Judith Lebiez überzeugt erneut mit einer starken Neuaufnahme ins Repertoire. Judith Lebiez und ihr Team verlassen bekannte, vielleicht auch ausgetretene Pfade. Sie geben hierzulande wenig gespielten Komponist*innen und Stücken Raum. Die innovativen und künstlerisch beeindruckenden Inszenierungen machen neugierig auf zukünftige Produktionen. Nach der umjubelten Premiere eine Woche zuvor fand auch die folgende Aufführung anhaltenden Applaus. Fünf weitere Vorstellungen, die nächste morgen um 19.00 Uhr, stehen auf dem Spielplan. Termine unter Mecklenburgisches Staatstheater.
Titelfoto: Ensemble Schwerin und Opernchor (Foto:@Silke Winkler)