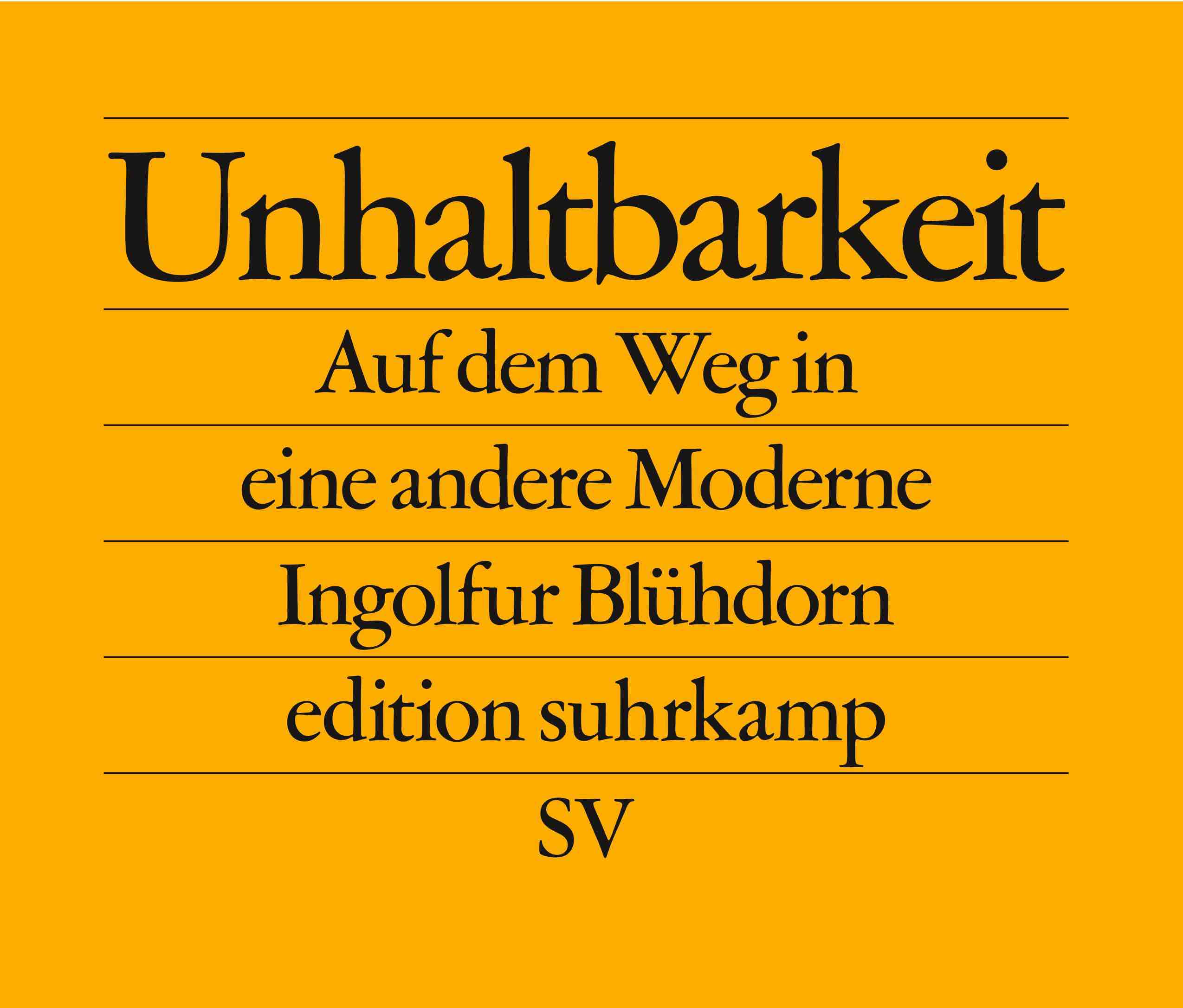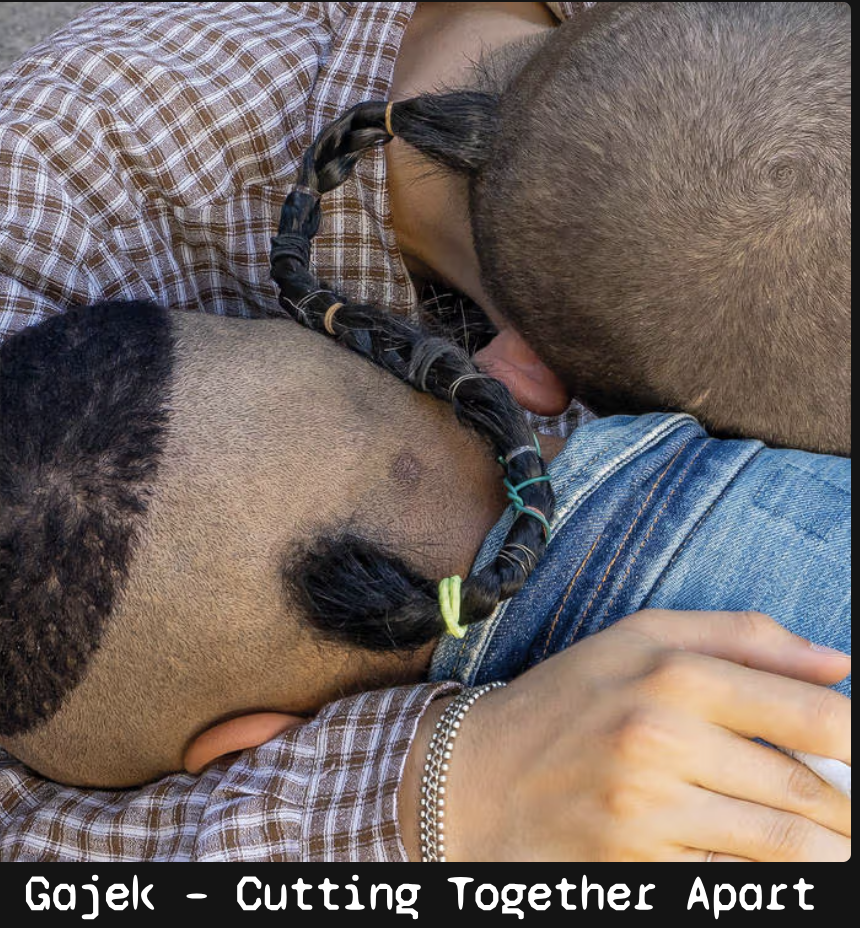von Gerald Ullrich
Im April 2024 erschien das Buch „Unhaltbarkeit“ des in Wien lehrenden Politikwissenschaftlers Ingolfur Blühdorn. Es hat im gleichen Jahr bereits eine weitere Auflage erfahren, was für eine rasante Aufnahme spricht. In einer soziologischen Fachrezension hieß es gleich nach Erscheinen, das Buch werde (oder sollte) „einschlagen wie eine Bombe“, denn es räume mit allerlei wohl gehegten Gewissheiten und Überzeugungen auf und treibe die Leser „aus der Komfortzone“.
In der aktuellen Krise der geopolitischen Ordnung, mit dem Zerbrechen des transatlantischen Bündnisses, kann man die Aktualität der Überlegungen und Argumente von Blühdorn kaum übersehen.
Aber der Reihe nach. Der Titel des Buchs und sein Untertitel, nämlich „Unhaltbarkeit – Auf dem Weg in eine andere Moderne“, sind für seinen Inhalt Programm. Es geht vordergründig um das Zerplatzen von Hoffnungen auf eine ökologisch-emanzipatorische Transformation der Gesellschaft. Also, dass am Ende eine Lebensweise gefunden wird, die nicht mit verheerenden regionalen und globalen Kollateralschäden durch kapitalistische Industrieproduktion und Wirtschaft verbunden ist. Eine Lebensweise, die eine Begrenzung des Ressourcenverbrauchs erreicht, so dass alle Menschen auf diesem Planeten ein auskömmliches Leben haben. Dies erweise sich zusehends als unhaltbar. Und zwar nicht als objektiv unhaltbar, sondern weil dieselben Gesellschaften, die (in ihren links-alternativen Kreisen) eben diese Hoffnungen gehegt hatten, inzwischen längst der eigene Wohlstand viel wichtiger geworden ist, auch wenn dieser als „imperiale Lebensweise“ auf Kosten anderer ausgelebt werde.
Die „spätmodernen“ Gesellschaften hätten, so Blühdorn, statt der sozialökologischen Emanzipation die Subjektzentrierung vorangetrieben, ohne dass es je ein dazu komplementäres, überzeugendes und verbindliches Narrativ der Selbstbegrenzung gegeben habe. Kurz gesagt hat sich anstelle des ursprünglichen Aufbruchs in eine alternative, gerechtere Welt ein Prozess entfaltet oder beschleunigt, der in eine ganz andere Moderne führt. Diese sei, so Blühdorn, im krassen Gegensatz zu den ursprünglichen Wertvorstellungen und Normen, vor allem am Einzelnen ausgerichtet, seinen Ansprüchen auf Freiheit, Selbstverwirklichung usw.
Begrenzungen individueller Handlungsmöglichkeiten, die sich aus einem Anspruch des Gemeinwesens (oder auch den legitimen Ansprüchen von fern lebenden Anderen) ergeben, würden demgegenüber als unerträgliche Beschneidung der eigenen Freiheit und Autonomie erlebt. Dies habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie und ihre Politisierung deutlich zu erkennen gegeben. Dies erschwere die unerlässliche Kompromissbildung und den Konsens in demokratischen Gesellschaften.
Auch die Bedeutung von Emanzipation und Autonomie habe sich zunehmend verwandelt. Anders als man es zu Zeiten des gesellschaftlichen Aufbruchs in den 1970er Jahren erwartet und erhofft hatte, sei diese in der Spätmoderne keineswegs mehr explizit politisch zu deuten (der Bürger als wirklicher Souverän und Gestalter des gesellschaftlichen Wandels). Vielmehr werde der Mensch in den spätmodernen, hyperkomplexen Gesellschaften, die zudem vor schier unlösbaren Herausforderungen und Problemen stünden, komplett überfordert. Blühdorn diagnostiziert hier eine neue und andere „Emanzipation“, nämlich „Befreiung von Mündigkeit“! Dies mag einem wie ein Widerspruch in sich erscheinen, aber auch dies, die Gültigkeit von Rationalität und Widerspruchsfreiheit, sei gebunden an soziale Normen, die nicht in Stein gemeißelt seien und sich derzeit im Übergang in eine „andere Moderne“ befänden. Mit der Überforderung des Bürgers in der Spätmoderne greift Blühdorn die allenthalben sichtbare Krise der Demokratie auf, die in der sich abzeichnenden „anderen“ Moderne mutmaßlich durch Transformation in eine autoritär-autokratische Gesellschaft überwunden werde.
Das liest sich krass und auch unverständlich, was dem Rezensenten sowie dem Umstand anzulasten ist, dass über dreihundert Seiten soziologischer Theorie nicht ohne Blessuren in einem knappen Absatz komprimiert werden können.
Das Besondere dieses Buchs ist, dass Blühdorn die Dynamik der sich abzeichnenden anderen Moderne, die nach seinen Erwartungen eine autoritäre Gesellschaft mutmaßlich asiatischer Prägung sein wird, gewissermaßen als unerwünschte Nebenwirkung derselben Kräfte und Einflüsse herleitet, die ursprünglich zur Befreiung der kapitalistischen Industriegesellschaft aus ihren selbstzerstörerischen Zwängen gedacht/erhofft waren. Der Autor betont an etlichen Stellen, dass er sich als Beschreibender gesellschaftlicher Veränderungen betrachtet und weit davon entfernt ist, die sich abzeichnenden Tendenzen legitimieren oder gar gutheißen zu wollen. Aber Soziologie sei (im Unterschied zur Religion) nicht dazu da, Hoffnung zu stiften, sondern Gesellschaften zu beschreiben, wie sie sind und nicht, wie wir sie uns wünschen. Blühdorn sieht nicht nur das „öko-emanzipatorische Projekt“ als überholt an, sondern meint, dass wir gerade das Ende der „westlichen Moderne“ erleben. Dieses Ende stehe bevor – nicht aber das „Ende der Menschheit“, das eher ein „Mobilisierungsnarrativ“ jener Menschen sei, die noch an die Einlösung der bisherigen Werte glaubten (und dabei nicht zur Kenntnis nehmen wollten, dass die spätmodernen Gesellschaften in Wahrheit längst andere Wege eingeschlagen hätten, die Blühdorn in einem vorherigen Buch bereits als nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit charakterisiert hatte).
Die Aktualität des Buchs liegt für mich auf der Hand, denn mit der Verwandlung der USA in einen Gegenspieler der EU spielt sich bereits eine Transformation von Demokratie in autoritär-autokratische Gesellschaft vor unseren Augen ab. Mit der Fixierung auf die USA wiegen die Europäer sich aber noch in dem Glauben, auf der „richtigen Seite“ zu stehen, während in Wahrheit dieselben Prozesse der Entdemokratisierung der Demokratie auch in der EU weit fortgeschritten sind. (siehe dazu auch Saxer, der in einem frei zugänglichen Artikel die Ereignisse auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz im Sinne von Blühdorn als Ende der liberalen Weltordnung und Aufbruch in eine autoritär-autokratische Moderne skizziert).
Blühdorns Buch ist starker Tobak, leider sehr theorielastig, aber für alle jene eine wichtige, intellektuell herausfordernde Lektüre, die etwa auch aktuelle Bücher zur Verfassung der Spätmoderne mit Interesse lesen (etwa Reckwitz oder Rosa). Ein „Muss“ ist dieses Buch für jene, die die Bücher des Soziologen Ulrich Beck schätzen. Dessen Denkweise begegnet einem in diesem Buch auf fast jeder Seite – wenn auch inhaltlich gänzlich anders, als es Beck im Sinn hatte (und es sich wohl auch Ingolfur Blühdorn gewünscht hätte).
Ingolfür Blühdorn, Unhaltbarkeit – Auf dem Weg in eine andere Moderne.
edition suhrkamp 2808, Suhrkamp Verlag, Berlin, 2024, Broschiert, 384 Seiten,
20 Euro