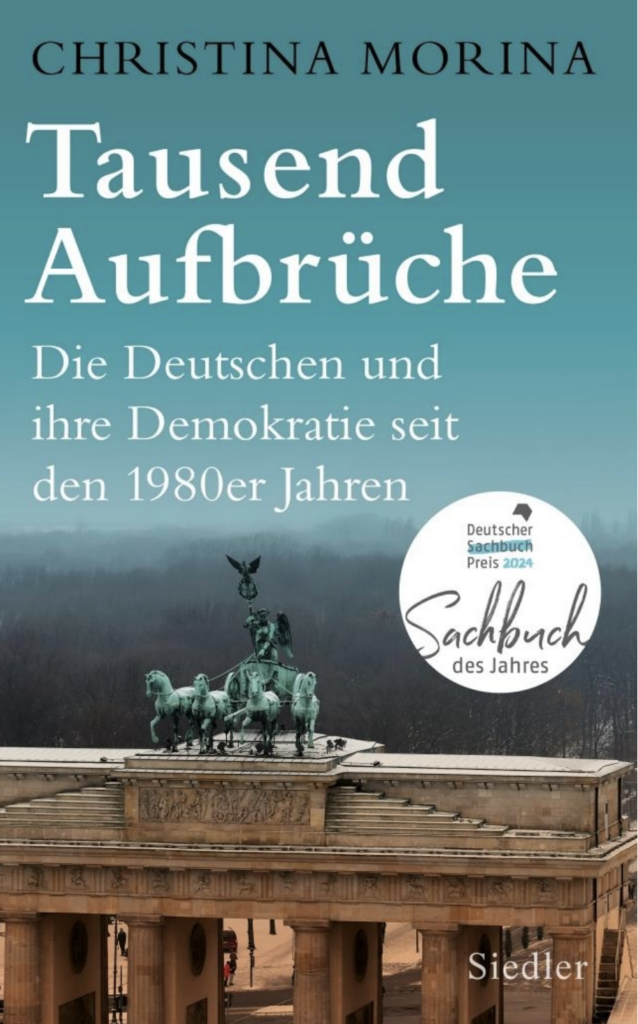von Hans-Peter Klös
Eine erfolgreiche neue Bundesregierung muss eine gute Balance zwischen Veränderungsbereitschaft und Bewahrungswünschen finden. Eine große Mehrheit der Bevölkerung muss davon überzeugt werden, dass für eine dringend erforderliche Zeitenwende unser gesamtes Gemeinwesen zu ertüchtigen ist. Anders als in der an ihren inneren Unvereinbarkeiten gescheiterten Ampelkoalition wird ein nachhaltiger gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technischer Fortschritt auch mit Zumutungen für alle Bevölkerungsgruppen verbunden sein müssen. Andernfalls wäre ein weiteres relatives Zurückfallen mit der Gefahr eines säkularen Abstiegs Deutschlands und von aggregierten Wohlstandsverlusten unvermeidlich. Es muss sich vieles ändern, damit die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Wirksamkeit unseres Sozialstaats erhalten bleiben.
Ökonomische und ökologische Zukunftssicherung
Eine zukunftsorientierte neue Bundesregierung darf sich dabei auch nicht ständig von der Demoskopie treiben lassen. Die jeweils neueste Befragung präsentiert meist das Wünschbare, aber nicht das für dessen Umsetzung erforderliche Pflichtenheft für die Politik1. Ohne Zweifel muss Politik beachten, was das Volk will, aber sie darf ihm nicht ständig nach dem Mund reden. Das politische Handeln muss sich vielmehr – getreu dem Auftrag an jede Bundesregierung, Schaden vom Volk abzuwenden – ganz elementar der ökonomischen und ökologischen Zukunftssicherung verschreiben. Es darf deshalb auch nicht vor balancierten Korrekturen vergangener Fehlentscheidungen, einem beherzten Anpacken von bisherigen Fehlentwicklungen und dem Einleiten der dafür erforderlichen Reformen zurückschrecken, denn: „Gelegentlich stolpern die Menschen über eine Wahrheit, aber dann richten sie sich auf und gehen weiter, als sei nichts geschehen“ (Winston Churchill).
Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün?
Die Zusammensetzung einer zukünftigen Bundesregierung ist noch offen, doch sind nach derzeitigem Stand der Sonntagsfragen entweder eine schwarz-rote oder eine schwarz-grüne Mehrheit realistisch2. Der wichtigste Anhaltspunkt für eine Bewertung, welcher Regierungskonstellation am ehesten eine erforderliche Zukunfts- und Reformorientierung zugetraut werden kann, sind neben Erfahrungen mit Regierungsphasen die vorgelegten Programme der Parteien. Zwar lesen sich diese vielfach wie ein parteipolitisches Wünsch-Dir-Was und sind allenfalls eine Willensbekundung für zukünftiges Regierungshandeln. Dennoch lässt bereits eine Schlagwortsuche der vier Wahlprogramme von Union, SPD, GRÜNEN und FDP eine erste Approximation an die programmatische Zukunftsorientierung der konkurrierenden Wahlprogramme zu: Macht man diese an den vier Suchworten „Wirtschaft“, „Digitalisierung“, „Innovation“ und „KI“ fest, tauchen diese Schlagworte bei der CDU rund 200-mal, bei den GRÜNEN über 190-mal, bei der FDP hingegen nur rund 155-mal und bei der SPD weniger als 150-mal auf3.
Habeck vor Scholz und Merz
Nimmt man nur diese vier Stichworte, so weist Schwarz-Grün ein höheres Potenzial für Zukunftsorientierung auf als andere Koalitionsoptionen. Eine personale Ebene kommt hinzu: Nach allgemeiner demoskopischer Einschätzung weist der GRÜNEN-Spitzenkandidat Habeck derzeit ein höheres personales Mobilisierungspotential auf als die Kanzlerkandidaten Merz und Scholz4, weil er am ehesten durch Sachlichkeit und Bereitschaft zu einer Fehlerkultur überzeugt. Ein Weg zu Schwarz-Grün setzt aber voraus, dass diese Koalitionsoption den Bürgern ein positives und gleichzeitig realistisches Transformationsbild zeichnen kann. Daher werden die Wahlprogramme dieser beiden Parteien einmal in knapper Form daraufhin gescannt, welche Lösungen sie für die Handlungsfelder anbieten, die Priorität haben sollten:
- Klimafreundlicher industrieller Strukturwandel
- Höheres gesamtwirtschaftliches Investitionsniveau
- Demografiefestere Sozialversicherungen
- Effektivere Migrationssteuerung
- Leistungsfähiger Staatsaufbau
- Innere und äußere Sicherheit
Klimafreundlicher industrieller Strukturwandel und ein höheres gesamtwirtschaftliches Investitionsniveau: Die Union setzt auf die Senkung der Unternehmensbesteuerung auf höchstens 25 Prozent, die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, steuerliche Anreize für Wagniskapital, die Einführung einer „Gründerschutzzone“, eine Hightech-Agenda für Forschung, Innovationen, Technologie, Transfer und Entrepreneurship, ein 3,5-BIP-Prozent-Ziel für Forschung und Entwicklung und den Ausbau von Rechenkapazitäten für KI für Forschung und Startups. Unterstützend sollen ein modernes Wettbewerbsrecht, eine europäische Cloud, der Abbau von Doppelstrukturen im Datenschutz auf Bundes- und Länderebene und eine innovationsoffene Umsetzung des AI-Acts wirken. Kritische Infrastrukturen und Unternehmen sollen vor „feindlichen“ ausländischen Übernahmen geschützt werden. Die Stromsteuer soll gesenkt und der Emissionshandel ausgeweitet werden. Bei den genannten Punkten sind keine echten Sollbruchstellen zum Programm der GRÜNEN zu erkennen: Sie möchten die Digitalisierung der Wirtschaft durch KI vorantreiben, robuste Cybersicherheitsstandards setzen, die Datenschutzbürokratie abbauen, Startups bei der Vergabe besser berücksichtigen und One-Stop-Shops für sie einführen, Schlüsseltechnologien wie KI, Quantentechnologie, Mikrochips, Biotechnologie, Robotik und Raumfahrt stärker fördern und den AI-Act schnell umsetzen. Klimapolitisch wollen sie Klimaschutzverträge ausweiten, die Stromsteuern auf das EU-Mindestmaß senken, eine Strompreiskompensation für energieintensive Unternehmen ermöglichen, den europäischen Energiemarkt ausbauen und ein Klimageld einführen. Anders als die Union wollen sie aber am Verbrennerverbot festhalten.
Demografiefestere Sozialversicherungen: Die Union möchte Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen durch einen angepassten Einkommensteuertarif entlasten, die Sozialversicherungsbeiträge wieder auf 40 Prozent begrenzen, Überstundenzuschläge bei Vollzeitarbeit steuerfrei stellen, die Pendlerpauschale erhöhen und eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit ermöglichen. Das Bürgergeld soll durch eine „Neue Grundsicherung” ersetzt, Eigentum und Vermögen sollen durch höhere Freibeträge bei Grunderwerb- und Erbschaftsteuer sowie beim Sparen gefördert werden. Rentenkürzungen soll es nicht geben, aber eine Aktivrente und eine Frühstart-Rente sollen sowohl längeres Arbeiten als auch eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge fördern. Auch die GRÜNEN halten an der Rente mit 67 fest, wollen aber flexiblere Übergänge in Altersteilzeit und Anreize zur Weiterarbeit sowie eine ergänzende Kapitaldeckung einführen. Sie wollen das Bürgergeld beibehalten, die Mindestlöhne erhöhen, prekäre Beschäftigung abbauen, den Weg in eine Bürgerversicherung einschlagen, Privatversicherte in den Finanzausgleich des Gesundheitssystems einbeziehen und Kapitaleinkünfte zur Finanzierung von Gesundheit und Pflege heranziehen.
Effektivere Migrationssteuerung: In der Migrationspolitik möchte die Union die deutschen Staatsgrenzen durch konsequente Zurückweisungen schützen, Asylverfahren beschleunigen, Rückführungen verstärken, Asylsuchende in sichere Drittstaaten überführen, den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten aussetzen, freiwillige Aufnahmeprogramme beenden, Sozialleistungen für Ausreisepflichtige am Grundsatz „Bett, Brot und Seife“ ausrichten und das europäische Asylrecht ändern. Die GRÜNEN verfolgen demgegenüber deutlich andere Ziele als die Union: Dazu gehören eine gemeinsame europäische Migrationspolitik, eine grund- und menschenrechtskonforme Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) auf nationaler Ebene, ein konsequentes Vorgehen gegen illegale push-backs, das Recht auf Einzelfallprüfung und ein Nichtzurückweisungsgebot. Sie sind auch gegen die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, aber für die Zusammenarbeit mit Dritt- und Transitstaaten sowie für weitere Migrationsabkommen. Dauerhafte stationäre Binnengrenzkontrollen, die EU-rechtlich ohnehin fragwürdig sind, werden abgelehnt, rechtsstaatliche Kontrollen an den Außengrenzen und eine zuverlässige Registrierung der Menschen aber ebenso befürwortet wie eine staatliche EU-Seenotrettung.
Leistungsfähigerer Staatsaufbau: Die Union möchte einen modernen Staatsaufbau durch ein eigenständiges Digitalministerium, die Bündelung der „Digitalressourcen“ im nachgeordneten Bereich, einen Bürokratieabbau durch „Bürokratiechecks“ und die Regel „one in, two out“, die Ansiedlung des Normenkontrollrats und der Zuständigkeit für den Bürokratieabbau im Kanzleramt sowie einen verstärkten Einsatz von KI in Ämtern umsetzen. Die GRÜNEN streben eine Bündelung von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Budgets für Digitalisierung, die Einführung eines Digitalchecks, die zentrale Bereitstellung aller staatlichen Verwaltungsangebote in einer „Deutschland-App“, die Umsetzung eines „Once-Only”-Prinzips und von One-Stop-Shops sowie die Digitalisierung von Visaverfahren an.
Bezüglich der inneren und äußeren Sicherheit gibt es Ähnlichkeiten: Die Union befürwortet steuerliche Anreize für Cybermaßnahmen von KMU, den Ausbau des BSI zur Zentralstelle für Informations- und Cybersicherheit, den Ausbau der Cyberfähigkeiten der Bundeswehr, die Wiedereinführung eines Wehrdienstes, die Erfüllung mindestens des 2-Prozent-Ziel der NATO, die Verzahnung ziviler und militärischer Fähigkeiten zur Cyberabwehr sowie einen Pakt für Bevölkerungsschutz, während die GRÜNEN die IT-Infrastruktur gegen Cyberangriffe aus dem Ausland stärken, die IT-Sicherheitsanforderungen erhöhen und ebenfalls das 2-Prozent-Ziel der NATO als Mindestvorgabe erfüllen wollen. Markante Unterschiede gibt es aber bezüglich der Methoden und der Reichweite einer Vorratsdatenspeicherung.
Übereinstimmungen und Unterschiede
Diese kurze Deckungsanalyse der Wahlprogramme von Union und GRÜNEN bezogen auf unabdingbare Modernisierungsziele unseres Gemeinwesens zeigt ein gemischtes Bild: Auf der einen Seite scheuen beide Parteien vor Zumutungen in den Sozialversicherungen erkennbar zurück. Es gibt zudem größere Übereinstimmungen bezüglich einer technologiebasierten, auf Schlüsseltechnologien und zukünftige Leitmärkte zielenden Unterstützung eines industriellen Strukturwandels, wie er auch in Mecklenburg-Vorpommern etwa in der maritimen Technik oder der Energieversorgungstechnik vonstattengeht. Schließlich scheint es eine größere Übereinstimmung über Grundsätze der Verteidigungsfähigkeit bei Schwarz-Grün als bei Schwarz-Rot zu geben, zumal Habeck inzwischen sogar ein 3,5-Prozent-BIP-Ziel bei den Militärausgaben befürwortet.
Auf der anderen Seite überwiegen in den Programmen die Unterschiede. Dies betrifft zunächst die Art und die Finanzierung von industriepolitischen Aktivitäten zwischen beiden Parteien: Die Union will an der Schuldenbremse grundsätzlich festhalten. Die GRÜNEN hingegen befürworten wie auch die SPD eine Reform sowie eine auf fünf Jahre befristete 10-Prozent-Investitionsprämie für Unternehmen und Investoren und einen neuen „Deutschlandfonds“ für Bund und Länder. Es gibt ferner eine Unverträglichkeit in der Atompolitik, weil die Union an der Option Kernenergie mit Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation, Small Modular Reactors und Fusionskraftwerken festhalten will. Weiterhin sind die steuerpolitischen Vorstellungen für Vermögende weitgehend unvereinbar: Die Union lehnt eine Vermögensteuer ab, die GRÜNEN befürworten aber eine “Milliardärssteuer”. Am gravierendsten aber ist die Unvereinbarkeit der migrationspolitischen Vorschläge beider Parteien.
Chance nur mit Lockerungsübungen
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Schnittmengen aus den Programmen beider Parteien zwar ein Potenzial für eine ökonomische und ökologische Modernisierungsagenda bieten könnten. Dem stehen aber noch große programmatische Unterschiede bezüglich der Migrationspolitik, der öffentlichen Finanzen und in Teilen auch in der Klima- und Sozialpolitik entgegen. Im Fall einer rechnerischen Mehrheit für Schwarz-Grün müssen die Parteien daher ausloten, ob und wo inhaltliche Gegensätze durch Kompromisse überwunden werden können. Diese könnten vor allem aus einer Lockerungsübung der Union bei der Schuldenbremse mit Blick auf ein Infrastruktur- und Militär-Sondervermögen bestehen, dem deutliche Zugeständnisse der GRÜNEN bei der Verringerung der Asylmigration entsprechen müssten. Zudem könnte die Union ihre nicht gegenfinanzierten Steuerentlastungspläne abmildern und mit den GRÜNEN stärker die fiskalische Nachhaltigkeit der zunehmend defizitären Sozialversicherungen in den Mittelpunkt gemeinsamen Regierens stellen. Wenn dadurch Wirtschaftskraft und Klimaschutz und Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung zum Markenzeichen einer Reformpolitik gemacht werden könnten, gebührt Schwarz-Grün auch auf Bundesebene eine Chance.
Vgl. die jüngste INSA-Umfrage vom 29.12.2024, laut der die angeblich die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 entscheidenden TOP5-Items die Inflationsbekämpfung, die Sicherung der Rente, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und die Sicherung der Energieversorgung sind. Vgl. BILD-Zeitung; Die Wünsche der Deutschen an den nächsten Kanzler: https://www.bild.de/politik/inland/exklusiv-umfrage-der-wunschzettel-an-den-naechsten-kanzler-676d38c637459a19cd659541. ↩︎
Vgl. Neueste Wahlumfragen im Wahltrend zur Bundestagswahl, Stand: 28.12.2024, https://dawum.de/Bundestag/. So würde Deutschland wählen, DER SPIEGEL, 4.1.2025 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sonntagsfrage-umfragen-zu-bundestagswahl-landtagswahl-europawahl-a-944816.html ↩︎
Vgl. bitkom: Übersicht der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025, Politik-Update für Bitkom-Mitglieder, Stand: 19.12.2024 ↩︎
Vgl. Umfragen. Lindner verliert an Ansehen – und wird von Wissing überholt, in: DER SPIEGEL 2/2025, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/umfrage-nach-dem-ampel-aus-volker-wissing-ueberholt-christian-lindner-a-83e40d34-869d-4e40-bc5b-b8ba443241f3. ↩︎
.

Hans-Peter Klös ist Volkswirt und war Geschäftsführer eines Wirtschaftsforschungsinstituts. Er hat im Oktober 2024 ein Buch unter dem Titel „Die betreute Marktwirtschaft. Für eine neue Balance zwischen Bürger und Staat“ im Kohlhammer-Verlag Stuttgart veröffentlicht. Er dankt Malte Ristau für wichtige Hinweise zu diesem Beitrag.