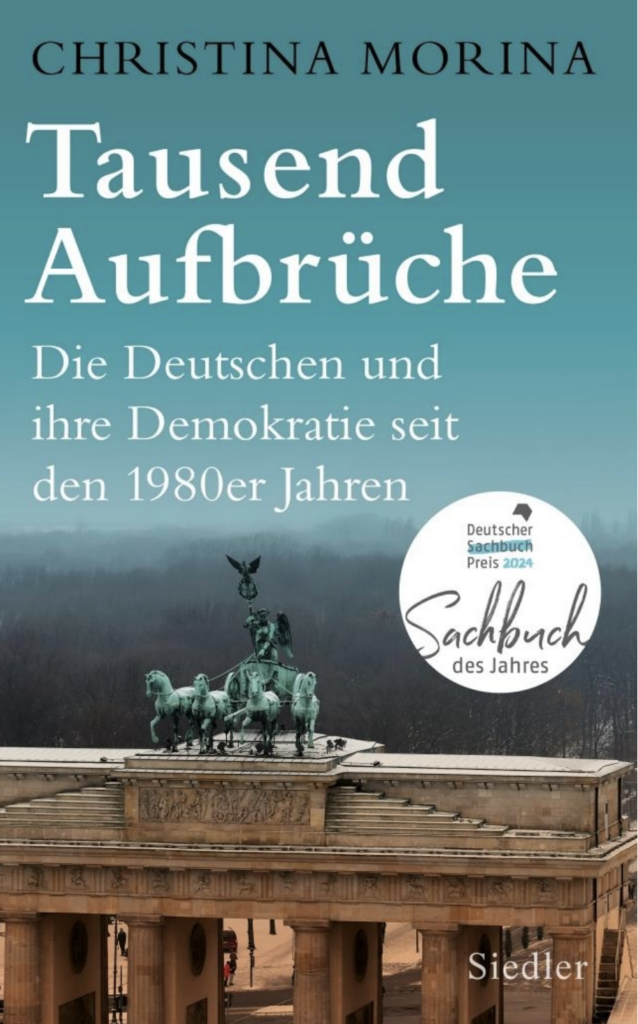von Wolfgang Kowalsky
Was ist los? Was ist zu tun? Welche Bedeutung haben die geopolitischen Verwerfungen? In den USA wurde Trump zum Präsidenten gewählt. Gleichzeitig zerfasert Europa, das sich selbst als großer globaler Akteur sieht: Ohne Regierung sind Österreich und Belgien (seit 9. Juni 2024), Regierungen auf Abruf gibt es in Frankreich und in Deutschland, und in den meisten anderen europäischen Ländern schwächeln die Kabinette. Rechtsextreme Regierungen in den Niederlanden und Italien, bald auch in Österreich und Belgien. Ist die viel beschworene Brandmauer zum Brandbeschleuniger geworden?
Orbán oder Meloni zu Trump?
Parallel zum Niedergang Europas gewinnen die BRICS an Bedeutung. Die EU-Mitglieder nehmen dies entweder nicht zur Kenntnis, übersehen es, missinterpretieren es oder ignorieren es bewusst. Europa sieht sich unverändert als Leuchtturm der Demokratie, als Vorbild für die Verbindung von ökonomischem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, gepaart mit kultureller Vielfalt und natürlich Meinungsfreiheit. Die Welt sieht Europa als eine strauchelnde Entität, die durch Unfähigkeit den eigenen Niedergang hinnimmt oder sogar beschleunigt. Die Entwicklung läuft wie eine self-fulfilling prophecy bei abwesender EU. Oder genauer: Sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament tragen durch permanentes Fingerhakeln mit einzelnen Mitgliedstaaten wie Ungarn dazu bei, Europa auseinanderzudividieren, statt alle Kräfte zu bündeln. Nur ein Beispiel: Die Kommission verweigert die Zahlung an strukturschwache Regionen in Ungarn und umgehend springt China in die Bresche. Vielleicht hat Gabriel Felbermayr recht und die EU sollte Orbán zu Trump schicken, um Unheil abzuwenden – und/oder Meloni? Beide sind relativ harmlos im Vergleich zu den über sie verbreiteten Gruselgeschichten und könnten sich womöglich effizienter für Europa einsetzen als die Kommissions- oder Parlamentspräsidentin, mancher Kommissar oder Europaabgeordnete. Vielleicht einfach mal versuchen, unorthodoxe Wege zu beschreiten in diesen unorthodoxen Zeiten.
Schuldenbremse und Verfall der Infrastruktur
In Deutschland lässt sich die Entwicklung zum Schlechteren bestens besichtigen. Stichworte sind Deindustrialisierung, Wohlstandsverluste, Verfall der Infrastruktur (Bahn, marode Brücken, viele öffentliche Gebäude). Dazu kommen jede Menge ideologische und das heißt unproduktive Debatten, sei es über den Niedergang des kleinstaatlich zersplitterten Bildungswesens, über Digitalisierungsrückstände oder Migration (globales Für und Wider statt klarer Einwanderungsregeln, getrennt von einem modernisierten Asylrecht, das den seit dem Zweiten Weltkrieg eingetretenen Wandel berücksichtigt). Zum Bild passt ideologisch bedingtes unergiebiges Pro-Contra bei Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Zukunftsinvestitionen. Die freiwillige Selbstzentriertheit zeigt sich beim Verharren im Prokrustesbett der Schuldenbremse: Ein Blick über die Grenzen hätte genügt, um zu erkennen, wie unsinnig es ist, eine politische Maßnahme in Verfassungsrang zu erheben. Nun weiß keiner, wie aus der Zwangsjacke herauszukommen wäre. Selbstkritik der Initiatoren wäre der erste Schritt – aber keiner traut sich. Zur Auffrischung der Erinnerung: Einzig die Gewerkschaften haben sich damals dagegen ausgesprochen.

Selbstzentriertheit behindert auch den Kampf gegen Rechtsextremismus, der vor allem der Bestätigung der Lagergrenzen gilt: Die Brandmauer sei unverzichtbar. Gut gegen Böse, Demokraten gegen Faschisten. Doch hilft dieses moralisch aufgeladene Instrumentenköfferchen? Diese Art Antifa hat bislang bloß bewirkt, den vermeidbaren Aufstieg der Rechtsextremisten zu verstetigen. Damit soll keinesfalls behauptet werden, dies sei ein ausschlaggebender Faktor für den Aufstieg des Rechtsextremismus, doch die Empörungswellen bleiben bestenfalls unwirksame Aktionen, schlimmstenfalls tragen sie ungewollt mit zum Aufstieg bei – zumindest zur Dauerthematisierung.
Die Ausbreitung des Rechtsextremismus bzw. -populismus ist mit Händen zu greifen: in Italien, Österreich, in Wartestellung in Frankreich, vielleicht sogar in Deutschland? Im Übrigen ist die Begriffsverwendung inkonsistent: Bei der ersten österreichischen Regierung mit FPÖ-Beteiligung herrschte in den Medien helle Aufregung, bei der israelischen Regierung wird das Etikett „rechtsextreme Regierung” systematisch weggelassen. Wenn von der AfD die Rede ist, darf der Zusatz „gesichert rechtsextrem“ nicht fehlen: Was sollen solche Sprachregelungen bewirken? Faschistisch oder eben rechtsextrem ist eine Definitionsfrage, über die sich streiten lässt. „Gesichert“ ist es damit noch lange nicht; welche Instanz sollte die Erkenntnis „sichern“ können? Eine Wahrheitsbehörde? Statt „gesichert“ wäre korrekt zu sagen: nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes.
Die Partei „Die Linke“ ist eine „gesichert” linke Partei? Fördert eine solche Aussage Erkenntnisse oder gleitet kritischer Journalismus hier ab in Begriffsverwirrung? Dazu gehört die Tendenz zu Ausdehnung und Überdehnung der Begriffe, wenn rechts und rechtsextrem und sogar faschistisch wie Synonyme verwendet werden. Aus Sicht von Aktivisten mag das Sinn ergeben, doch die Lernkurve wird so flach gehalten.
Als außenpolitischer Akteur ist Europa in Wirkungslosigkeit versunken. Effizientes Handeln als multilateraler Akteur war gestern. Heute starrt Europa wie das Kaninchen auf die Schlange nach Amerika, China und Russland. Angststarre führt zu Immobilität. Diplomatie findet nicht statt. Wirkmächtige Initiativen, um die Massentötungen in Gaza zu stoppen, unterbleiben. Sprachregelungen spiegeln die Unfähigkeit einzugreifen wider: niemals „rechtsextrem“ im Zusammenhang mit der israelischen Regierung sagen, niemals Genozid im Zusammenhang mit Gaza, Hamas immer mit dem Zusatz „radikal-islamistisch“; fehlt nur das „gesichert“.

Initiativen zur Beendigung des Krieges – sei es in der Ukraine, sei es in Palästina – kommen weder von der EU noch von Deutschland, sondern nur von außerhalb. Insbesondere in Deutschland wird jeder kleinste Versuch einer Debatte sogleich von Eiferern mit Schaum vor dem Mund unterbunden. Als Totschlagargumente reichen simple Etikette wie „russlandfreundlich, Putin-Freund“, um jegliches Argumentieren zu unterbinden. Es bleibt ein schaler Geschmack zurück, wenn es nur noch Feinde gibt, die schärfstens zu bekämpfen sind, keine Gegner mehr zum Streiten oder Polemisieren.
Zu einer gespaltenen Gesellschaft, in der Gegner zu Feinden werden, gehört auch, dass Kompromisse als Schwäche gedeutet und tendenziell abgelehnt werden. Deutschland und Frankreich haben sich jahrhundertelang um Elsass-Lothringen gestritten und viele unschuldige Menschen sind in den Kriegen sinnlos gestorben. Ohne einen Kompromiss würde heute noch gekämpft. Albert Camus setzte sich für ein friedliches Zusammenleben von Franzosen und Algeriern ein und wurde dafür verunglimpft.
Kompromisse grundsätzlich abzulehnen, heißt, selber zum Ayatollah zu werden und weltliche Kämpfe oder Kriege in quasi-religiöse Auseinandersetzungen zu verwandeln, die keinerlei Vernunftargumenten zugänglich sind. Es geht nur noch darum, keine Schwäche zu zeigen. Zivilisatorischer Fortschritt ist dann außen vor.
Wie kommt es, dass Durchhalteparolen oder Siegeserwartungen realistische Einschätzungen verdrängen konnten? Einen Sieg über Russland, das größte Land der Welt, haben Napoleon und Hitler versucht. Die New York Times hat am 6.1.2025 in einem Gastbeitrag hinterfragt, wie es zu den unrealistischen Lageberichten kommen konnte, dass ein US-Pressesprecher behaupten konnte, die USA hätten 300.000 afghanische Soldaten ausgebildet, die nun die Aufgabe der dort stationierten US-Streitkräfte übernehmen könnten. Drei Wochen vor dem überstürzten Abzug. Der Gastautor vermutet, dass in den Berichten zum Iran oder zur Ukraine ebenfalls systematische Schönfärberei den Blick und damit das Urteilsvermögen trübt. Er geht nicht so weit zu sagen, dass die Grenze zu Propaganda überschritten wird, aber die Andeutung genügt.
Außenpolitik als Belehrung und Proklamation hat sich als ineffizient erwiesen und dient letztlich nur der eigenen Selbstvergewisserung. Doch ist eine Person, die der ständigen Selbstvergewisserung bedarf, wirklich am richtigen Posten als Chefin der Außenpolitik, die immer auch Diplomatie umfasste? Ständig wird Kriegsgefahr beschworen und damit eine Aufstockung des Rüstungshaushalts gerechtfertigt. Ein Blick auf die Geschichte Chinas zeigt, dass China nie einen Angriffskrieg geführt hat, wohingegen die Zeiten kurz sind, in denen die USA nicht in einen Krieg verwickelt waren.
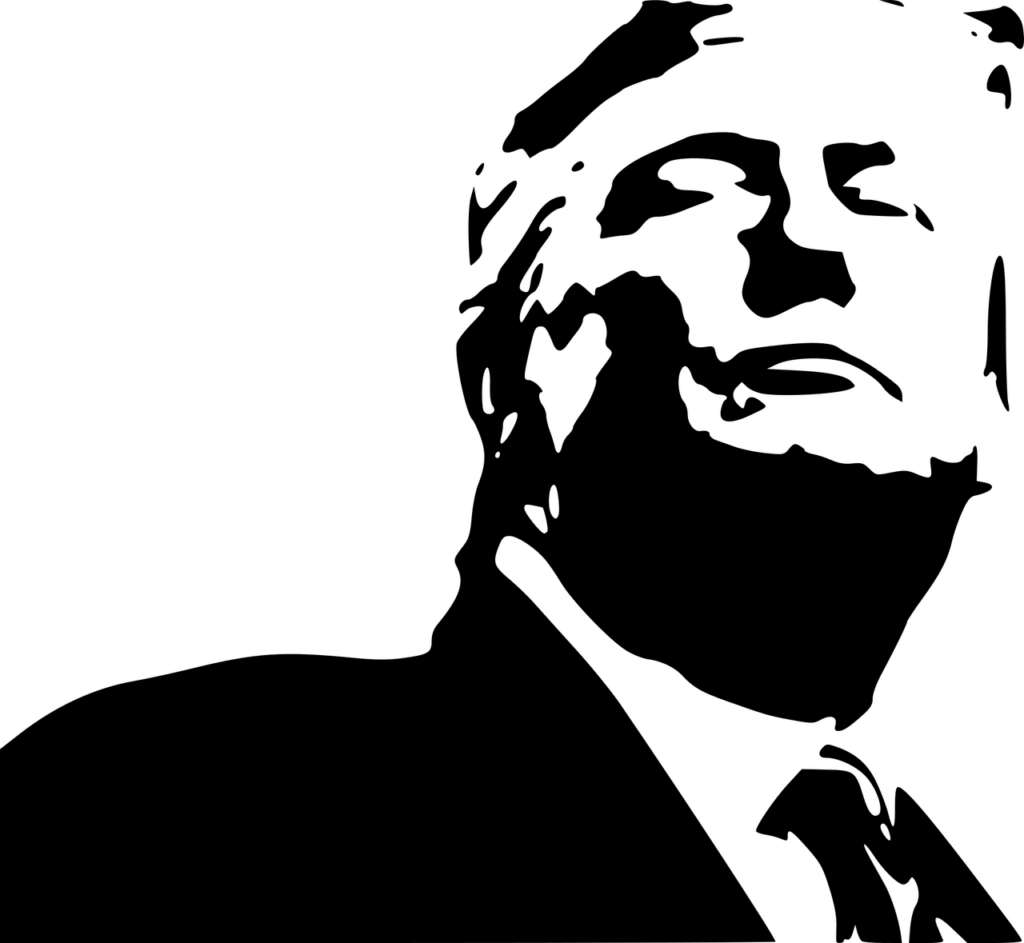
Gefordert ist also ein klarer Blick, Überblick, Reflexion, auch und gerade angesichts unliebsamer Ereignisse und Entwicklungen. Immer wenn Trump seine Provokationen loslässt, hat er eine doppelte Reaktion einkalkuliert: Empörung und emotionale Verwirrung hervorzurufen, damit der Gegner fassungslos bleibt, ist beabsichtigt. So demobilisiert er seine Gegner und mobilisiert seine Anhänger und generiert ein vielfaches Echo. Wie lässt sich verhindern, in diese Falle zu tappen? Am besten einen nüchternen Kopf behalten und nicht in moralisierende Höhen abdriften, um die Wellen von Aufgeregtheit zu vermeiden und die Provokationen ins Leere laufen zu lassen. Distanz wahren, erst einmal tief durchatmen, an Zen denken und analysieren: Was will der Rechtspopulist erreichen, wozu will er seine Anhänger mobilisieren, welche Pläne der Gegenseite will er durchkreuzen? Und nicht der Frage ausweichen, die die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe, die einen Essay „Für einen linken Populismus“ veröffentlicht hat (bei Suhrkamp), gestellt hat, ob nicht Linkspopulismus ein wirksameres Gegengift wäre.
Aufklärung bleibt wichtig. Dazu gehört aber auch, nicht in simplistischen Erklärungsmustern zu verharren. Viele Journalisten in den tonangebenden Medien wie Zeit, FAZ, aber auch in den öffentlich-rechtlichen greifen gerne auf das Argumentationsmuster zurück, demzufolge etwas, das Trump oder Le Pen oder die AfD behauptet, für die anderen Parteien tabu sein muss. Die Lektion haben die Rechtsextremisten schon lange gelernt: Sie wissen, dass alles, was sie an Slogans in die Welt setzen, die Gegenseite aus dem Feld kickt. Weil der Antifa-Reflex einsetzt und Empörungswellen auslöst.
Also, was tun? Es gibt nicht die eine einzige erfolgversprechende Strategie, kein Allheilmittel. Um die erstarkende Hegemonie der Rechtspopulisten zu brechen, bedarf es zunächst einer Bündelung der Kräfte. Eine Zersplitterung der Linken wie in Frankreich führt zum gemeinsamen Niedergang. Ein Gegeneinander in Europa pflastert den Weg in die Bedeutungslosigkeit. Vornehmlich auf Provokationen der Rechtspopulisten zu reagieren, erschöpft auf die Dauer und führt viele in die Frustration oder zu einer Abkehr von der politischen Arena, einem Rückzug ins Private und in die „private Blase”. Die Kraft, sich auf eine bedeutungsvolle Agenda zu einigen und dafür entschieden einzutreten, geht verloren. Sich klarmachen: Rechtspopulisten sagen Dinge nicht nur wegen ihrer Bedeutung, sondern wegen der erwarteten und erwartbaren Reaktion. Die Ausdifferenzierung in ein Zuviel an Identitäten stärkt die Zerfaserung und erleichtert der Gegenseite das Spiel. Sie schafft es, mit Emotionen Bündnisse zu schmieden, die nur schwer zu knacken sind. Sie hat es geschafft, die linke Hegemonie implodieren zu lassen. Es erfordert langen Atem, Durchhaltevermögen und Zuversicht, einen linken Populismus auszuarbeiten, der die Kräfteverhältnisse wieder wendet. Mehr Bürgerräte, mehr direkte Demokratie. Wie schrieb Gramsci: „Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.“
(Titelfoto: Gerd Altmann, pixabay)

Wolfgang Kowalsky, Dr., Dipl.-Soz., Studium in Berlin und Paris-Nanterre, tätig bei Grande Ecole HEC bei Paris, bei der IGMetall Grundsatzabteilung, Fellow am Wissenschaftszentrum NRW, zuletzt Referent beim Europäischen Gewerkschaftsbund. Diverse Publikationen zu europäischen und anderen aktuellen Themen.